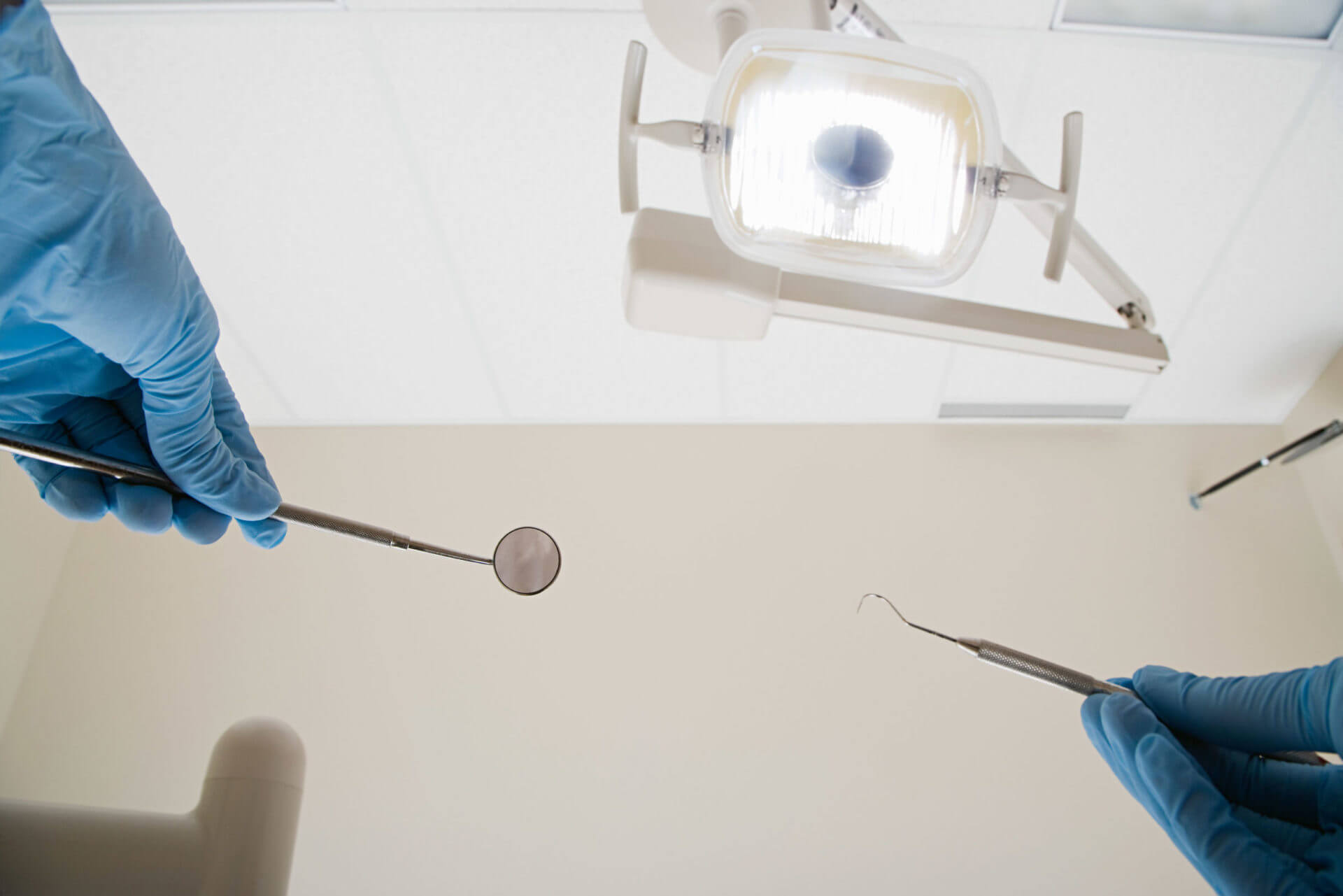1,7 Millionen Menschen in Deutschland sind von Demenz betroffen. Wie Zahnärzte mit Patienten umgehen sollten, die an Demenz erkrankt sind, und wie für Behandler und Team überhaupt erkennbar ist, dass sie es mit einem dementen Menschen zu tun haben, darüber haben wir mit der Dipl.-Pädagogin Melanie Feige vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Dozentin für Gerontopsychiatrie und Pflegeexpertin für Menschen mit Demenz, gesprochen.
Frau Feige, was macht Demenz mit einem Menschen?
Pauschal kann ich das nicht sagen, denn es gibt verschiedene Formen dieser Krankheit. Viele merken bei einer beginnenden Demenz aber schon, dass etwas nicht stimmt: In meinem Kopf stimmt etwas nicht, ich vergesse immer mehr, ich fühle mich auch anders. Es gibt Patienten, die damit offen umgehen und ärztliche Hilfe suchen. Aber es gibt auch Menschen, die merken, dass etwas nicht stimmt, aber eine Fassade, einen Widerstand aufbauen. Viele jener Betroffenen geben anderen die Schuld, wenn etwas nicht gelingt, und wollen sich selbst nicht eingestehen, dass etwas Tiefgreifenderes mit ihnen geschieht. Spüren sie Symptome, sagen sie sich: Ich habe heute aber auch starke Kopfschmerzen oder Ich bin heute etwas vergesslich. Bei einer vaskulären Demenz, also gefäßbedingt, werden Patienten oft depressiv.
Wie können Behandler und Praxismitarbeiter erkennen, ob es sich bei einem Patienten um einen Demenzerkrankten handelt?
Einmal wird es deutlich dadurch, dass sich Themen innerhalb eines Gesprächs immer wieder wiederholen. Meine Tochter wohnt in Stuttgart und hat ein Enkelkind bekommen. Nach ein paar Minuten wieder: Meine Tochter wohnt in Stuttgart
Aber man merkt es auch daran, dass einige eine Antwort umgehen, eine Entscheidung nicht treffen können. Beispiel: Möchten Sie Tee oder Kaffee? Dann kommen Antworten wie Weiß ich jetzt auch nicht oder Entscheiden Sie das mal. Manchmal ist eine Erkrankung daran zu bemerken, dass die Kleidung nicht zusammenpasst oder jemand jahreszeitlich nicht entsprechend angezogen ist. Auch Desorientierung ist nicht selten. In der Praxis wird der Weg zur Toilette erklärt: Die Person geht los und vergisst gleich, wohin sie muss.
Wo wir beim Thema Milieu sind. Wie sollte eine Praxis aufgestellt sein, um Demenzkranke behandeln zu können?
Das fängt mit Kleinigkeiten an, zum Beispiel, dass gut erkennbar ist, wo es zum WC geht. Also: Können sich Patienten gut in der Praxis orientieren? Ist das Wartezimmerschild gut zu erkennen? Liegen nicht nur irgendwelche Journale über Yachten und architektonische Herausforderungen bereit, sondern auch mit Nachrichten aus der Umgebung? So findet der alte Mensch etwas, wozu er Bezug herstellen kann.
Wie kann einem solchen Patienten die Behandlung erleichtert werden?
Eine kurze Plauderei zu Beginn nimmt Spannung, baut eine Beziehung auf. Es ist oft empfehlenswert, den Patienten nicht hilflos im Behandlungsstuhl sitzen zu lassen, sondern ihm etwas in die Hände zu geben; etwa ein Nestelkissen. Oder ihn in die Arbeit einzubeziehen: Wenn ich Sie behandele, benötige ich die Nierenschale, können Sie die während der Behandlung halten? Dass er das Gefühl hat: Ich kann etwas beitragen. Der Vorteil, den Zahnärzte haben, ist, dass der Zahnarzt einen Menschen durch das ganze Leben begleitet. Trotz Demenz kennen Patienten also die Institution Zahnarzt. Allerdings sollten Behandler überlegen, wie sie ausschauen, wenn sie sich über die Patienten beugen. Mundschutz und Mikroskopbrille Demenzerkrankte können nicht einschätzen, dass der Arzt das alles braucht, und sind hochgradig irritiert. Das Beste, was man machen kann, ist, zu Beginn das Gesicht zu zeigen, das den Patienten freundlich anlächelt. Mundschutz und Brille lassen sich während der Behandlung nicht vermeiden. Aber vielleicht ist es möglich, dass die ZFA weniger im Gesicht hat, wenn man merkt, dass der Patient unruhig wird.
Haben Sie weitere Tipps, wie Behandler und Team auf die klassischen Verhaltensweisen von Demenzerkrankten reagieren können, um ihr Vertrauen und so ihre Compliance zu gewinnen?
Man sollte immer die Position des Patienten verstehen. Demenzerkrankt das heißt oft, dass der Patient alt ist. Bei alten Menschen geht vieles langsamer bis sie im Wartezimmer sitzen, von dort dann im Behandlungszimmer sind, das dauert alles länger. Bei Demenz ist es auch so, dass viele Informationen länger brauchen, bis sie angekommen sind. Bitte geben Sie mir Ihre Versichertenkarte und Sie können im Wartezimmer warten, ich bringe Ihnen die Karte dann. Das sind nicht viele Informationen, aber ein Mensch mit Demenz kann sie in der Reihenfolge nicht abrufen. Besser ist, eine Information nach der anderen zu geben: Bitte geben Sie mir Ihre Versichertenkarte.
Vielen Dank, bitte warten Sie im Wartezimmer.
Es gibt eine Demenzlogik. Was ist darunter zu verstehen?
Hinter einem Verhalten von betroffenen Patienten, über das Nichtbetroffene sagen würden: Was soll das?, steckt meist eine Logik. Wenn die Handtasche weg ist, ist für den Betroffenen klar, dass sie gestohlen worden sein muss. Wenn die Demenz voranschreitet, ist der Patient nicht mehr in der Lage, zu reflektieren. In unserem Beispiel ist für den Demenzerkrankten die Tatsache, dass die Handtasche weg ist, nicht auf eigenes Fehlverhalten zurückzuführen.
Wie sieht es bei chirurgischen Eingriffen aus, etwa wenn ein Implantat aufgrund einer fortschreitenden Periimplantitis explantiert werden muss: Sollte das unter Vollnarkose geschehen trotz postoperativen Delirs?
Es gibt Patienten, die halten während einer Behandlung still. Aber es ist mit Demenz schwierig nachzuvollziehen, was gerade passiert. Und: Demenz ist eine Aufmerksamkeitsstörung. Das heißt, über einen längeren Zeitraum ruhig zu sitzen, mit geöffnetem Mund und vielen Geräuschen, das ist für Menschen mit Demenz nicht lange aushaltbar. Zwar erhöht eine Vollnarkose im höheren Lebensalter bei bereits bestehender kognitiver Einschränkung das Delirrisiko signifikant, dennoch würde ich im Falle eines chirurgischen Eingriffs auch eine Vollnarkose in Betracht ziehen, um zu verhindern, dass der demenzerkrankte Patient einem hohen Leidensdruck oder zahlreichen Terminen ausgesetzt ist. Umso wichtiger ist die Vorbereitung auf diese OP. Neben vertrauten Personen sollten andere wesentliche Aspekte im Blickfeld stehen .
Wie müssen diese Patienten auf die Vollnarkose vorbereitet werden?
Alles sollte stressfrei ablaufen, Angst sollte genommen werden. Benzodiazepin ist sehr delirfördernd und sollte vermieden werden. Also muss die Umgebung anxiolytisch angepasst werden: Ein Angehöriger kann im Behandlungsraum die Hand halten. Vertraute Geräusche, Musik können helfen. Nach der OP ist es wichtig, schnell für eine Reorientierung zu sorgen. Also die Brille auf die Nase, das Hörgerät anlegen, sagen, welcher Tag ist.
Vielen Dank für das Gespräch.
OP-Vorbereitung
· Bei Mangelernährung: Gabe von proteinhaltiger Trinknahrung je zwei Mal täglich
· Bei Mangelzuständen: Substitution von Folsäure (5?mg/d p.o. bis zur OP) und Vitamin B12 (Cobalamin 2?mg/d p.o. bis zur OP)
· Bei Muskelschwäche: Progressives Krafttraining (wiederholtes Aufstehen und Hinsetzen, Gewichte wiederholt mit den Armen über den Kopf heben)
· Bei Eisenmangelanämie: Eisensubstitution (Fe-Carboxymaltose 1?g i.v. unter ärztlicher Supervision in Prämedikationsambulanz, entsprechend Therapieempfehlung)
· Bei Multimediaktion (>5 Präparate) oder v.a. inadäquate Medikation: Optimierung der Dauermedikation (Kontaktaufnahme mit Hausarzt)
· Immer: Anleitung zum Atemtraining, Aushändigung eines Atemtrainers
· Immer: Aufklärung über Maßnahmen der Delirprävention
· Immer: Verzicht auf Benzodiazepine zur Prämedikation
Quelle: Dr. Cynthia Olotu, Anästhesie UKE