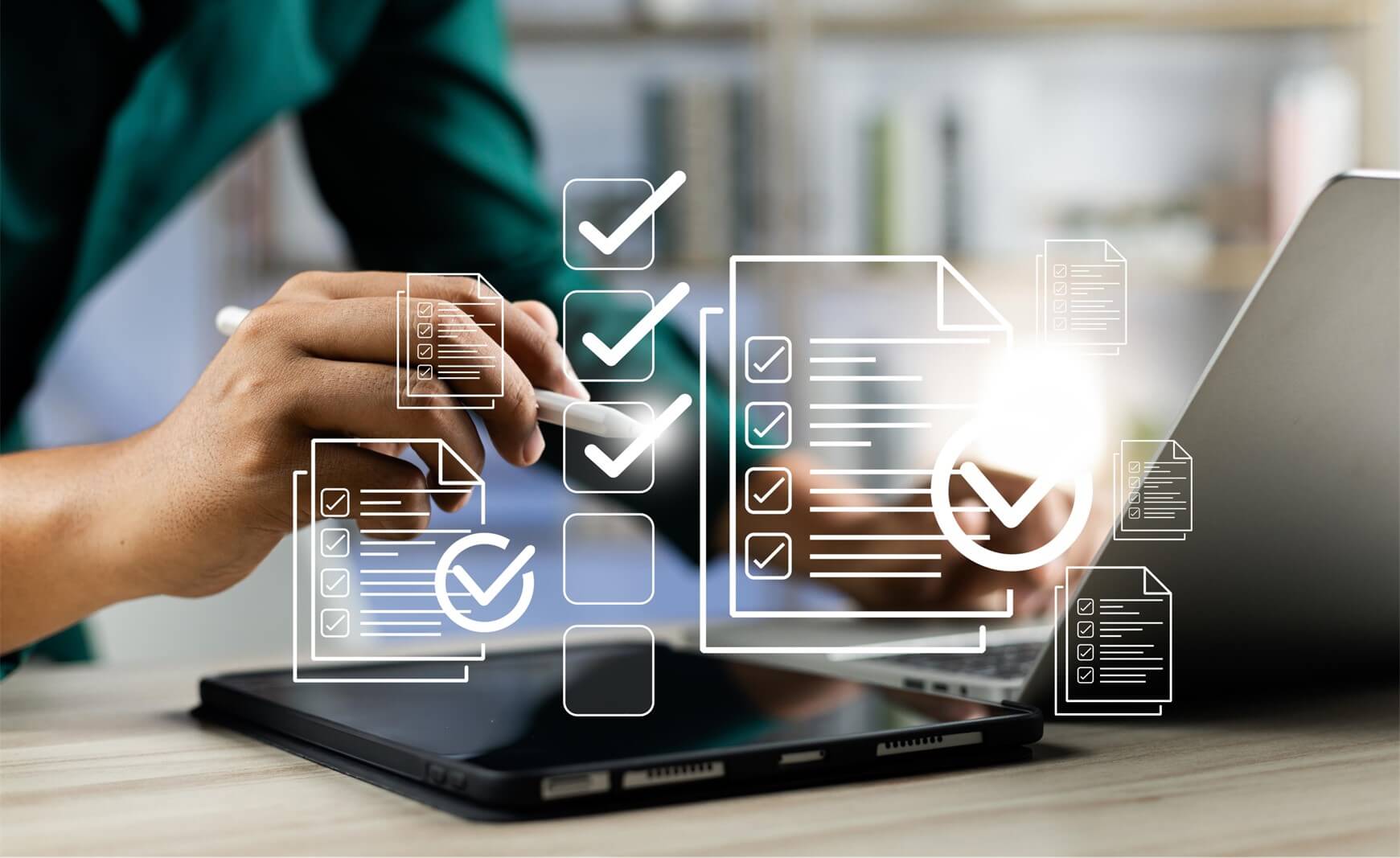Oralmedizin kompakt — Kurz-Empfehlungen: Leitlinie des Interdisziplinären Arbeitskreises Oralpathologie und Oralmedizin mit DGMKG und DGZMK
Rezidivierende Aphthen gehören zu den häufigsten Mundschleimhaut-Erkrankungen. Ihre Ätiologie ist wahrscheinlich multifaktoriell, diskutiert werden unter anderem Genetik, Infektionen, lokales Trauma und Stress.
In etwa 85 Prozent der Fälle handelt es sich um Minor-Aphthen, in zirka 10 Prozent um Major-Aphthen. Da schwere aphthoide Veränderungen in der Regel in Fachpraxen oder -kliniken diagnostiziert und behandelt werden, fokussiert diese Kurz-Empfehlung auf das Management von Minor-Aphthen. Detaillierte Informationen enthalten der Leitlinientext und der Methodenreport [1, 2].
A. Merkmale Minor-Aphthen (Typ Mikulicz)
- Oberflächliche Erosion oder Ulzeration, plan oder gering erhabener Randwall
- Durchmesser: meist 2 bis 5 mm, selten bis 10 mm
- Lokalisation: meist nicht keratinisierte Schleimhaut, ein bis vier Aphthen gleichzeitig
- Verlauf: Rasch entstehend, Schmerz mäßig bis stark
- Heilungsdauer: 7 bis 10 Tage, keine Narbenbildung
- Hohe Rezidivneigung, 3- bis 6-mal pro Jahr
Beim Typus herpetiformis (Typ Cooke, Anteil zirka 5 Prozent) entstehen multiple kleine Läsionen auf der gesamten oralen Schleimhaut. Major-Aphthen (Typ Sutton) dringen in tiefere Gewebeschichten ein, verheilen narbig, sind zwei bis vier Wochen präsent, sehr schmerzhaft und mit Lymphadenopathien verbunden. Aphthenähnliche (aphthoide) Läsionen manifestieren sich auch bei einigen Syndromen und systemischen Erkrankungen. Sie lassen sich zum Teil nur schwer von Aphthen unterscheiden.
B. Diagnostische Empfehlungen
Die Diagnose wird vor allem morphologisch gestellt (vergleiche Punkt A). Hinzu kommen:
- Eine umfassende oral- und allgemeinmedizinische Anamnese (Malabsorptions- und Mangelzuständen, Arzneimittel-Unverträglichkeiten, systemische Erkrankungen usw.)
- Eine intra- und extraorale Untersuchung (Inspektion und Palpation)
- Bei lokal begrenzten Läsionen zunächst mögliche mechanische Ursachen abklären, zum Beispiel durch Prothesen, Restaurationen, persistierende Fadenreste oder Watterollen, chemische oder thermische Irritationen, topische Medikamente
- Achtung: Bei Läsionen, die nach zwei Wochen nicht abheilen, sollten Patienten zur Abklärung möglicher maligner Veränderungen unverzüglich an spezialisierte Praxen oder Kliniken überwiesen werden.
C. Therapeutische Empfehlungen
Die Therapie chronisch-rezidivierender (rekurrierender) Aphthen der Mund- und Rachenschleimhaut (oropharyngeal) ist wegen ihrer unklaren Ätiologie symptomatisch ausgerichtet. Sie zielt auf:
- Linderung von Schmerzen und funktionellen Einschränkungen und
- Reduzierung von Häufigkeit und Schweregrad von Rezidiven.
Lokale Maßnahmen sind wegen des niedrigen Risikos systemischer Nebenwirkungen erste Wahl:
- Erste Therapiestufe: filmbildende Präparate, zum Beispiel AphtoFix (Hyaluronsäure, Aloe Vera, Zink) oder Sucralfat (Aluminiumhydroxid und Saccharose-octasulfat)
- Zweite Therapiestufe: glukokortikoidhaltige Haftsalbe (Triamcinolon-acetonid 0,1%)
- Laser (CO2, Dioden, Nd:YAG)
- Topische Adstringenzien (zum Beispiel Myrrhe) und Antiseptika (CHX-Gele)
- Topische Lokalanästhetika
- Antibiotische Spüllösungen (Tetrazyklin oder Minozyklin, bei Major-Aphthen)
Bei häufiger und die Lebensqualität des Patienten deutlich einschränkender Rezidivneigung kann eine systemische Behandlung erforderlich werden, zum Beispiel mit Glukokortikoiden. Bei komplexen Aphthosen werden lokale und systemische Maßnahmen kombiniert (siehe Flow-Chart unten). Eine Tabelle mit differenzierten therapeutischen Empfehlungen und weitere Hinweise enthalten der Volltext der Leitlinie (S. 21) und der Leitlinienreport [1, 2].
Konzept und Methodik
Die für diese Kurzübersicht verwendete Leitlinie gibt den Stand des Wissens von April 2023 wieder und gilt bis April 2028 [1, 2]. Sie richtet sich an Zahnärzte sowie an Fachärzte unter anderem für MKG-Chirurgie, HNO-Heilkunde, Dermatologie, Innere Medizin und Pädiatrie. Aufgrund der begrenzten Datenlage ist die Empfehlung konsensbasiert (S2k) und wurde in einem „nominalen Gruppenprozess“ von allen beteiligten Fachgesellschaften verabschiedet. Hier geht es direkt zur Leitlinie.
Dr. Jan H. Koch, Freising
Bei Kurz-Empfehlungen in der Rubrik Oralmedizin kompakt handelt es sich nicht um offizielle Publikationen von Fachgesellschaften, sondern um Beiträge mit fachjournalistischer Auswahl von Inhalten und ohne die in Leitlinien vorgegebene methodische Stringenz.
![Grafik: aus der Leitlinie, Seite 18 [1]](https://mgo-dental.de/wp-content/uploads/2025/07/Koch_leitlinie-aphthen-therapie-flowchart.png)
Literatur
[1] AKOPOM, DGMKG, DGZMK. Diagnostik und Therapieoptionen von Aphthen und aphthoiden Läsionen der Mund- und Rachenschleimhaut“, Long version, 2.0, 20230430, AWMF no. 007–101, https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/007–101.html, accessed 20250217. 2023.
[2] AKOPOM, DGMKG, DGZMK. Diagnostik und Therapieoptionen von Aphthen und aphthoiden Läsionen der Mund- und Rachenschleimhaut, S2k-Leitlinie (Leitlinienreport); AWMF-Registernummer: 007–101 Stand: April 2023; Gültig bis: April 2028. 2023.
Dr. Jan H. Koch ist approbierter Zahnarzt mit mehreren Jahren Berufserfahrung in Praxis und Hochschule. Seit dem Jahr 2000 ist er als freier Fachjournalist und Berater tätig. Arbeitsschwerpunkte sind Falldarstellungen, Veranstaltungsberichte und Pressetexte, für Dentalindustrie, Medien und Verbände. Seit 2013 schreibt Dr. Koch als fester freier Mitarbeiter für die dzw und ihre Fachmagazine, unter anderem die Kolumne Oralmedizin kompakt.