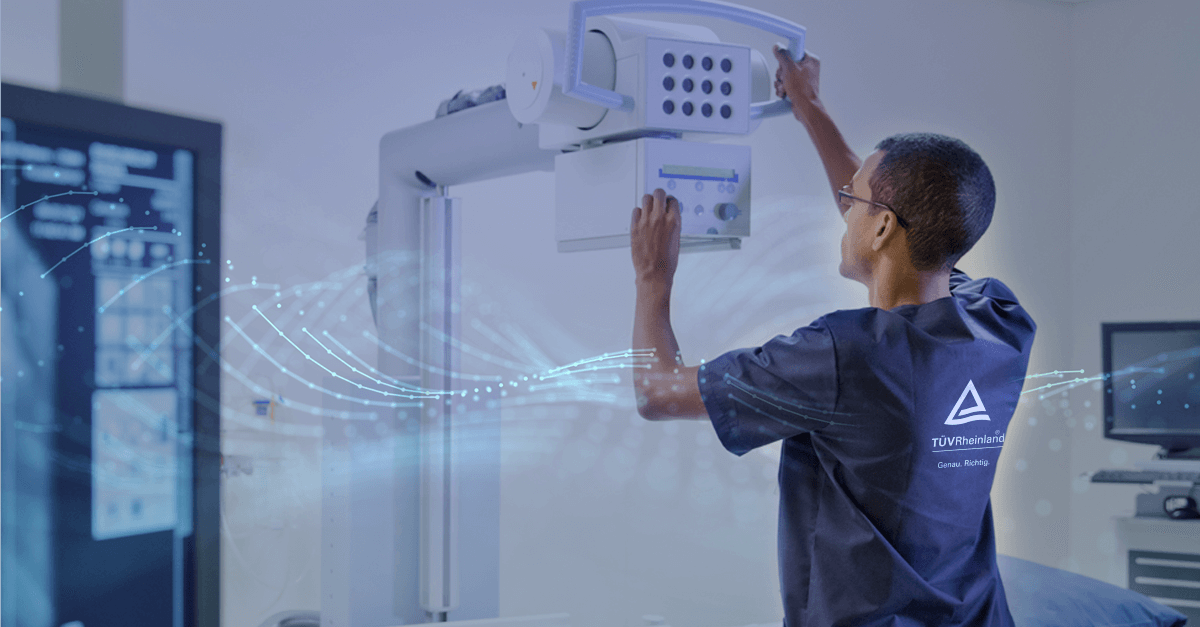Laut Wikipedia ist eine Schnittstelle der Teil eines Systems, welcher der Kommunikation dient. Betrachtet man einen Ablauf als Gesamtsystem und zerschneidet dieses, übernimmt die Schnittstelle die Datenübergabe an den Berührungspunkten der entstandenen Teilbereiche. In der digitalen Dentaltechnologie unterscheiden wir unterschiedliche Schnittstellenformate, die eine Interoperabilität zwischen CAD/CAM-Systemen ermöglichen. Aber Schnittstellen beziehen sich nicht nur auf den Austausch von digitalen Dateiformaten, sondern definieren jegliche Art der Interaktion. Im Dentalbereich ist somit bei der Restaurationserstellung die Übergabe der Abformung inklusive Bissnahme von der Praxis an das Labor ein solcher Berührungspunkt. Hierbei wird quasi die Information der Patientensituation von einem Ort beziehungsweise Teammitglied zum nächsten transferiert.
Die präzise und fehlerfreie Übergabe und Übernahme dieser Informationen ist für die weitere Erstellung des Zahnersatzes essenziell.
Frage an den Autor
Sind CAD/CAM-Abläufe nicht so präzise, dass Qualitätsprüfungen entfallen können?
Ztm.?Ralph Riquier: Digital unterstützte Arbeitsprozesse erzielen nicht per se eine höhere Genauigkeit (Zusammenspiel von Richtigkeit und Präzision) als analoge Arbeitsschritte. Der Vorteil des digital unterstützten Vorgehens ist der hohe Grad an Reproduzierbarkeit. Analoge Arbeiten unterliegen immer auch schwer kalkulierbaren Einflussfaktoren wie: Sorgfalt, Tagesform oder Ausbildungsstand und manuelle Fähigkeiten. Hier sind digitale Abfolgen einfacher zu standardisieren und ermöglichen so, Qualitätsschwankungen zu vermeiden. Nichtsdestotrotz gilt für jede Prozesskette, durch Prüfinstanzen an Schnittstellen Fehler im Vorfeld zu erkennen. Es kann ja nicht sein, dass bei unseren komplexen Arbeitsabläufen der Patient die einzige Prüfinstanz ist. Kein Autobauer würde je ein Fahrzeug zusammenbauen und an den Endkunden ausliefern, ohne vorher die Maßhaltigkeit der Einzelkomponenten geprüft zu haben.
Schnittstellen
In digitalen Zeiten wird die analoge Abformung immer häufiger durch intraorale Scans ersetzt. Die digitale Abformung wird als für den Patienten angenehmer beschrieben und Genauigkeitsuntersuchungen bescheinigen diesem Verfahren die klinische Eignung [1]. Der intraorale Scan ersetzt die analoge Abformung und verändert somit die Informationsübergabe (Abb.1). Hierdurch erweitert sich auch die Möglichkeit, an den Schwachpunkten dieser Schnittstelle zusätzliche Prüfkriterien zu etablieren.
Workflow
In der analogen Vorgehensweise folgt der Situationsabformung das Ausgießen in Gips und die Erstellung der Bissschablone im Labor. Nach der Präparation erfolgt wiederum beim Behandler die Präzisionsabformung sowie die Bissnahme, die anschließend wieder an das Labor geliefert werden. Dort wird nun erneut ausgegossen und die Lagezuordnung mit der Bissnahme in den Artikulator übertragen. Diese Arbeitsschritte sind nicht anhand von messbaren Qualitätskriterien überprüfbar. Die Qualitätsaussage, ob das Abformmaterial die benötigte Rückstellung erzielt oder das ausgegossene Gipsmodell wirklich die Dimensionierung der Abformung widerspiegelt, beruht auf Erfahrungswerten und nicht auf einem Prüfverfahren oder auf Prüfkriterien.
Der Arbeitsablauf in der digital gestützten Vorgehensweise kann nur selten ohne Modellerstellung erfolgen. Sobald der Restaurationsumfang zunimmt, ist eine laborseitige Modellfertigung obligat. Bei komplexen Fällen erfolgt die digitale Erstabformung in der Praxis über den intraoralen Scan. Dann werden die Daten via Internet an das Labor übermittelt. Das Erstellen der Bissschablone kann sofort auf Basis der digitalen Daten erfolgen (Abb.2) und mit dem 3-D-Drucker materialisiert werden (Abb.3 und 4). Nach der Präparation wird erneut digital abgeformt. Zur Bisslagebestimmung können die Kiefer im Schlussbiss mit eingesetzter Bissnahme von bukkal gescannt werden. Alle hier erfolgten Arbeitsschritte lassen sich durch den Behandler direkt am Computer überprüfen. Mögliche Ungenauigkeiten können so sofort korrigiert werden. Der Datentransfer erfolgt wieder über die Datenautobahn. Dem Labor obliegt nun die Aufgabe, die gewonnenen Daten exakt in die Restaurationserstellung zu übertragen. Neben dem Design der eigentlichen Restauration, das direkt auf den digitalen IOS-Daten erfolgen kann, muss zudem ein Präzisionsmodell für die Fertigstellung und zur Prozessüberprüfung erstellt werden. Aus dem Kieferscan berechnet der Techniker einen Modelldatensatz (Abb.5). Dies kann als Komplettmodell oder als Alveolarmodell mit herausnehmbaren Stümpfen gestaltet sein. Dieser Datensatz wird dann via 3-D-Druck in ein physisches Modell umgesetzt.
Qualität
Wie bei der analogen Modellherstellung können auch beim Prozess der digitalen Modellherstellung Fehler auftreten (Abb.6). Allerdings ermöglicht die digitale Welt eine Überprüfung der Fertigungsqualität. Aufgrund der Möglichkeit, Datensätze miteinander vergleichen zu können, lassen sich im digitalen Workflow alle Prozessschritte validieren. Durch Softwaretools wie QualityCheck (r2deiexmachina) hat man die Option, die intraoralen Scan- mit den Modelldaten sowie den gefertigten und eingescannten Modellen zu vergleichen (Abb.7 und 8). Hierzu müssen nur die intraoralen Scandaten als Referenzdatensatz mit den Modelldaten als Vergleichsdatensatz übereinandergelagert werden (Best-Fit Ausrichtung/Matching). Das Einschränken des Matchingbereichs ist wichtig, um undefinierte Bereiche, die den Best-Fit-Algorithmus negativ beeinflussen könnten, auszuschließen (Abb.9). Das Übereinanderlegen erfolgt dann mit einer Einklick-Ausrichtung (Abb.10). Das gewünschte Qualitätskriterium kann als Wert eingestellt werden. Im Anschluss werden die Abweichungen als Falschfarbendarstellung angezeigt. Die grünen Bereiche zeigen die Abstände der Datensätze unterhalb des eingegebenen Toleranzwertes (Abb.11). Die weitere Farbcodierung erfolgt entsprechend der Legende am rechten Bildschirmrand. Durch automatisches Erstellen eines Testreports kann das Ergebnis als PDF-Datei zur Dokumentation Verwendung finden (Abb.12). Über diese einfache Methode erhält das Labor erstmalig die Möglichkeit, einen Soll-/Ist-Vergleich zwischen zahnärztlicher Abformung und zahntechnischer Modellherstellung durchzuführen und somit mögliche Fehlerursachen frühzeitig zu erkennen. Genauso lassen sich die konstruierten Restaurationen gegen ihr gefertigtes Pendant abgleichen, um Fertigungsfehler ausschließen zu können (Abb.13 bis 15). Selbst eine weiterführende Überprüfung der Kieferscandaten nach Hinterschnitten oder Präparationswinkeln lässt die Datenanalyse zu (Abb.16).
Digitale Prozesse ermöglichen eine digitale Qualitätskontrolle und lassen so Fehler frühzeitig erkennen. Ebenso können sie zur eindeutigen Zuordnung eines Prozessfehlers beitragen. Die einfache Dokumentierbarkeit bietet eine zusätzliche Sicherheit, um den gesetzlichen Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie (MDR) zur Prozessvalidierung nachzukommen.
Zusammenfassung
Schnittstellen befinden sich auch in der digital unterstützten Zahnmedizin nicht nur bei der Verwendung von Dateiformaten. Schnittstellen sind überall, wo kommuniziert wird. Die Abstimmung an den Übergabestellen ist essenziell, um Fehler zu vermeiden. Damit die übergebenen Daten aber auch in den Nachfolgeprozessen nicht verfälscht werden, bedarf es einer fortwährenden Prüfung der Herstellungsprozesse. Die digitale Zahnmedizin ermöglicht diese Prüfbarkeit. Durch Datenabgleich mittels Best-Fit-Ausrichtung lassen sich schnell und aussagekräftig Eingangsdaten, wie ein Intraoralscan, und Ausgangsdaten, beispielsweise gefertigte Modelle, gegenprüfen. Was im manuellen Prozess undenkbar ist, lässt sich im digitalen als zusätzliche Kontrollinstanz abbilden. So können auch die Verantwortlichkeiten eindeutig zugeordnet werden. Der akkurate intraorale Scan obliegt dem Behandler, die akkurate Restaurationserstellung inklusive Arbeitsmodell dem Labor. Eine Grauzone, die seit Jahrzehnten bei der analogen Abformung an der Schnittstelle Abformung und Modellerstellung schlummert, kann im digitalen Workflow gänzlich beseitigt werden.
Die kleine Fibel der Dateiformate
Die für die CAD-Konstruktion in der Zahnmedizin eingesetzten Datei- oder Datenformate lassen sich in drei unterschiedliche Kategorien einteilen. Diese sind: Volumendaten, 3-D-Oberflächendaten und textbasierte Daten.
Volumendaten
Volumendaten übermitteln Informationen zum inneren Aufbau des gemessenen Objekts. Der dreidimensionale Aufbau bildet sich aus Voxeln, die farblich (zum Beispiel in Grauwerten) den Übergang von einer Materie in die nächste aufzeigen. Volumendaten entstehen beispielsweise beim digitalen Röntgen, bei der Magnetresonanz-, Computertomografie oder Sonografie. Als einheitlicher Standard für Praxen und Krankenhäuser im gesamten medizinischen Bereich wurde hierfür das DICOM-Datenformat entwickelt. Als offener Standard soll es die Interoperabilität zwischen verschiedenen medizinischen Anwendungen gewährleisten. Das DICOM-Format ist kein Dateiformat, sondern ein Datenformat (Datencontainer), der neben den eigentlichen Aufnahmen auch Metainformationen wie Patientennamen, Geräteparameter, behandelnden Arzt et cetera beinhaltet.
3-D-Oberflächendaten
Oberflächendaten geben die dreidimensionale Oberfläche eines Körpers wieder. Im Dentalbereich können sie entweder nach einer Vermessung, zum Beispiel als optischer 3-D-Scan, oder nach digitaler Konstruktion, zum Beispiel als Brückengerüst, entstehen (Abb.17)
XYZ-Koordinaten
Die einfachste Form, nach einer optischen- oder taktilen Vermessung, die Messergebnisse darzustellen: Jeder gemessene Punkt erhält drei Koordinaten, die seine Position auf den XYZ-Achsen eines kartesischen Koordinatensystems definieren. Diese Koordinaten werden in dem Dateiformat für jeden Punkt in einer Zeile tabellarisch aufgeführt (Abb.18).
-
Weitere Beiträge zu diesem Thema
Intelligenter Anamneselotse für die zahnmedizinische Praxis
Ara.onl revolutioniert die Anamneseerhebung: Eine digitale, wissenschaftlich fundierte Lösung zur Risikoklassifikation unterstützt Zahnärzte bei der sicheren, effizienten und patientenorientierten Betreuung – ab Mai 2025 verfügbar.Von der Chairside-Fertigung zur echten Single-Visit-Dentistry
Die Digitalisierung verändert nahezu alle Bereiche der Zahnmedizin und scheint sich teilweise durch immer intelligentere Technologien, smarte Algorithmen und vernetzte Plattformen selbst zu überholen. Dabei geht es längst nicht mehr nur um die Substitution klassischer Verfahren. Vielmehr werden ganze Prozessketten teilweise vollständig automatisiert. Prominentes Beispiel ist die Single-Visit-Dentistry. Wie mit einem intelligenten Workflow die Ansprüche an die Chairside-Fertigung neu definiert werden, beschreibt der Autor in diesem Artikel. Digitalisierung ist in der Zahnmedizin ein kontinuierlicher Prozess. Mit zunehmender Etablierung moderner Intraoralscanner eröffnen sich für Zahnärzte neue Möglichkeiten, Scandaten selbst zu verarbeiten. Früher eher etwas für Digital-Enthusiasten, machen intuitive Lösungen die Chairside-ProduktionTÜV: Röntgengeräte sorgfältig überwachen
Jedes fünfte dentalmedizinische Röntgengerät hat einen oder mehrere Mängel. Das ist ein Ergebnis des TÜV-Röntgenreports 2024, für den Sachverständige deutschlandweit 7.889 dentalmedizinische Röntgengeräte geprüft haben.