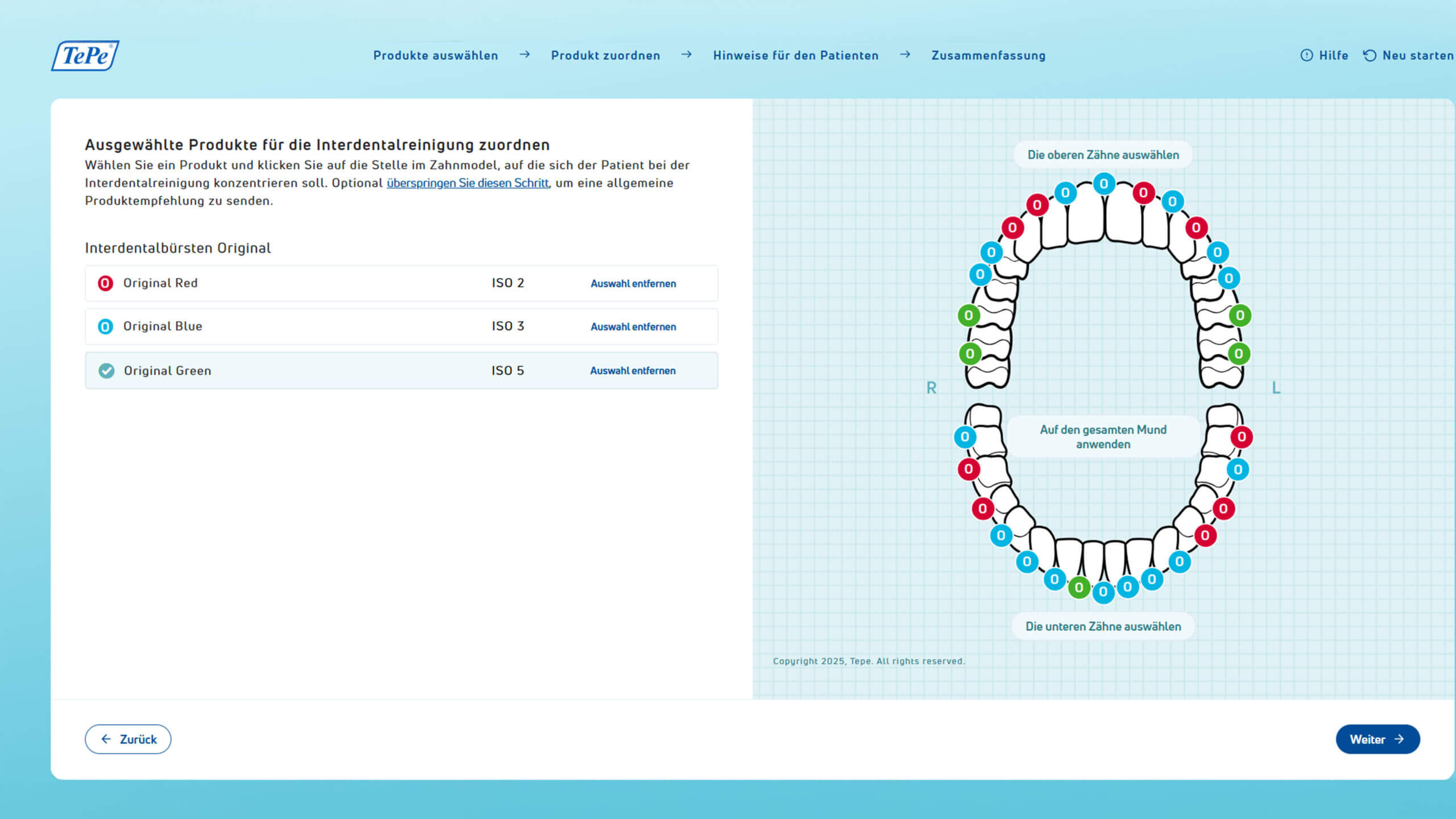Herr Prof. Lussi, was ist die Ursache für Mundgeruch?
Lussi: Nach einem immer noch verbreiteten Vorurteil sind Magen- und Atemwegserkrankungen für einen schlechten Atem verantwortlich. Aber zu fast 90 Prozent liegt der Ursprung in der Mundhöhle selbst, nämlich in erster Linie als Belag auf der Zunge oder bei Entzündungen des Zahnhalteapparates. Zersetzen Bakterien im Mund Speisereste, Eiweiße, Zellen oder Blutbestandteile, werden flüchtige Schwefelverbindungen sogenannte volatile sulphur compounds (VSC) freigesetzt. Dadurch entsteht ein Gemisch an Geruchsstoffen, das für die Nase des Gegenübers nicht immer schmeichelhaft ist. Vor allem auf der Zunge lagern bedeutend mehr Mikroorganismen als an anderen Stellen der oralen Schleimhaut.
Wie kann man oral bedingte Halitosis behandeln?
Lussi: Obwohl wissenschaftlich nur mäßig gut belegt, ist die mechanische Reinigung der Zunge von sichtbarem Belag mittels Zungenbürste oder Zungenschaber eine der meistgenutzten therapeutischen Maßnahmen. Sie reduziert die Keimzahl der VSC auf der Zunge. Allgemein anerkannt ist auch, dass Halitosis durch Essen verringert wird (Yaegaki et al. 2012). Dieser Effekt beruht auf der Selbstreinigung des Mundes beim Kauen von Nahrung. Die naheliegende Hypothese, ob Nahrungsmittel mit unterschiedlicher Kauintensität diesen Selbstreinigungsprozess beeinflussen, war bislang allerdings noch nicht erforscht worden. Meine Kollegen und ich konnten in einer Untersuchung an Patienten zeigen, dass eine kauintensive, faserreiche Mahlzeit den organoleptischen Wert, der den Grad der Atemfrische anzeigt, im Vergleich zu einer faserarmen Mahlzeit signifikant verbessern kann.
Je mehr Kauaktivität also ein Nahrungsmittel verlangt, desto besser für den Atem. Wie sind Sie in Ihrer Studie vorgegangen, um das zu zeigen?
Lussi: Wir untersuchten den Effekt eines einzelnen Verzehrs von Nahrung mit hohem Fasergehalt gegenüber dem von Nahrung mit niedrigem Fasergehalt und zwar auf verschiedene Halitosis-Parameter. Mundgeruch wird wie erwartet durch Essen von sowohl faserreicher als auch faserarmer Nahrung verringert. Es zeigte sich auch, dass der Verzehr faserreicher, kauintensiver Nahrung die Halitosis im Sinne der oben beschriebenen Atemfrische stärker verringert als der Verzehr des faserärmeren Kontrollmenüs.
Sie sagten, die organoleptische Bewertung erfolgte über einen Entfernungs-Index. Was hat man sich darunter vorzustellen?
Lussi: Dieser von Rainer Seemann (Seemann 2006, Seemann et al. 2014) zuerst beschriebene Index basiert auf der Tatsache, dass mit zunehmender Distanz Mundgeruch weniger wahrgenommen wird. Der Index beginnt mit Grad 0 = kein unangenehmer Mundgeruch. Bei Grad 1 wird Mundgeruch erst wahrgenommen, wenn eine Distanz zum Gegenüber von 10 cm besteht, bei Grad 2 sind es 30 cm. Die Skala endet mit dem Grad 4, bei dem schon bei 100 cm Entfernung Mundgeruch feststellbar ist.
Sie konnten zeigen, dass gutes Kauen von Nahrung den Mundgeruch vermindert. Dann müsste doch das Kauen von Kaugummi einen ähnlich positiven Reinigungseffekt haben und daher zur Bekämpfung von Mundgeruch beitragen können, oder?
Lussi: Das stimmt eigentlich, obwohl wir das nicht gemessen haben. Aufgrund der starken Speichelstimulation, die das Kaugummikauen auslöst, hilft das gegen Mundgeruch. Im Umkehrschluss bemerkt man den schlechten Atem beispielsweise morgens nach dem Aufwachen. In der Nacht hat man wenig Speichel. Proportional dazu steigt die Konzentration an flüchtigen Schwefelverbindungen. Folglich geht auch Mundtrockenheit meist mit schlechtem Atem einher (Tonzetich 1978).
Was gehört zu einer umfassenden Mundhygiene, die auch Halitosis vorbeugt?
Lussi: Optimale Prophylaxe sollte über die Zahnreinigung hinaus auch Zungenpflege mit einbeziehen. Abgesehen von Zungenbürste oder -schaber können hier kurzzeitig chemische Antiseptika helfen, die Bakterien im Mund zu reduzieren, wie zum Beispiel chlorhexidin- oder zinkhaltige Präparate. Für den Dauereinsatz sind sie ohne ärztliche Konsultation allerdings nicht empfehlenswert. Daneben gibt es in der Medizin bewährte pflanzliche Wirkstoffe, wie beispielsweise ätherische Öle, die vorbeugend und ausgleichend auf das natürliche Gleichgewicht der apathogenen Mundflora wirken. Zur dauerhaften Beseitigung chronischen Mundgeruchs ist eine Steigerung des Mundhygieneniveaus insgesamt nötig. Ganz grundsätzlich ist eine gute Speichelproduktion sehr wichtig, da der Speichel dafür sorgt, Speisereste abzutransportieren und Mikroorganismen zu reduzieren. Hierzu gehört, wie unsere Studie zeigt, kauaktive Nahrung, aber natürlich auch das Kauen zuckerfreier Kaugummis. Kaugummikauen wird übrigens auch neben dem Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta und möglichst geringem Zuckerkonsum als eine von drei täglich in Eigenregie durchzuführenden Maßnahmen in der aktuellen S2k-Leitlinie Kariesprophylaxe bei bleibenden Zähnen empfohlen. Quelle: 1 Adrian Wälti, Adrian Lussi, Rainer Seemann: The effect of a chewing-intensive, high-fiber diet on oral halitosis. A clinical controlled study. Swiss Dental Jorunal SSO 126: 782788 (2016). Literaturhinweise in Klammern beziehen sich auf die in der Studie aufgeführte Literatur.